KI in allen Lebenslagen – auch bei wissenschaftlichen Arbeiten?
Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass Künstliche Intelligenz gerade voll das große Ding ist. Für die einen ein echter Segensbringer, weil Arbeitsabläufe, Produktionsprozesse und vieles mehr einfacher werden sollen. Für die anderen Teufelszeug, weil die Maschinen irgendwann die Macht übernehmen könnten oder weil man einfach nicht mehr weiß, was echt ist und was nicht. Deepfakes in den sozialen Medien lassen grüßen. Italien wird beispielsweise gerade von einem Skandal erschüttert, bei dem massenhaft Fotos von Frauen geklaut wurden und zu pornografischen Inhalten verwurstet wurden. Wo liegt die Zukunft von KI? Ganz allgemein und besonders beim wissenschaftlichen Arbeiten? Ich möchte versuchen, eine Einschätzung aus der Sicht eines Laien zu geben, der nicht viel von Algorithmen versteht.
Was verstehe ich unter KI?
Ich glaube, dass ich unter KI etwas anderes verstehe als die meisten andere Leute. Ich bin mir beispielsweise nicht ganz sicher, ob ich Chat GPT als KI bezeichnen würde. KI beinhaltet für mich Intelligenz, künstlich zwar, aber intelligent. Und das bedeutet für mich, es existiert eine Fähigkeit des Reflektierens und des Lernens. Dazu gehören auch eine gewisse Problemlösungskompetenz und Kreativität. Chat GPT und seine Verwandten von Google und Co. machen zwar manchmal den Eindruck, über diese Fähigkeiten zu verfügen, aber letztendlich greifen sie nur auf immense Datenmengen zu. Die Algorithmen, mit denen sie programmiert wurden, sagen ihnen dann, was sie auf die ihnen gestellten Fragen antworten sollen. Das Ergebnis ist quasi nur eine Abfolge von Wörtern und Sätzen, die eine hohe Wahrscheinlichkeit dafür aufweist, letztendlich korrekt zu sein. Aber gelernt wird hier nicht. Es werden nur die Datenmengen erweitert und Wahrscheinlichkeiten verbessert. Man möge mich korrigieren, wenn ich hier einer Fehleinschätzung aufsitze. Aber die typischen Tools, die unser Leben einfacher machen sollen, wie Übersetzungshelfer, Bildgeneratoren, Meeting-Protokollanten, Bio-Tracker, auch Big Data Management, usw. sind keine selbstlernenden Systeme. Dabei verneine ich nicht, dass es im Bereich Machine Learning auch jetzt schon echte künstliche Intelligenzen gibt, deren Anwendungsbereich aber eng abgesteckt ist. KI ist für mich etwas, was sich potentiell selbst auf eine Stufe hin entwickeln kann, auf der es den Menschen die Macht entziehen kann.
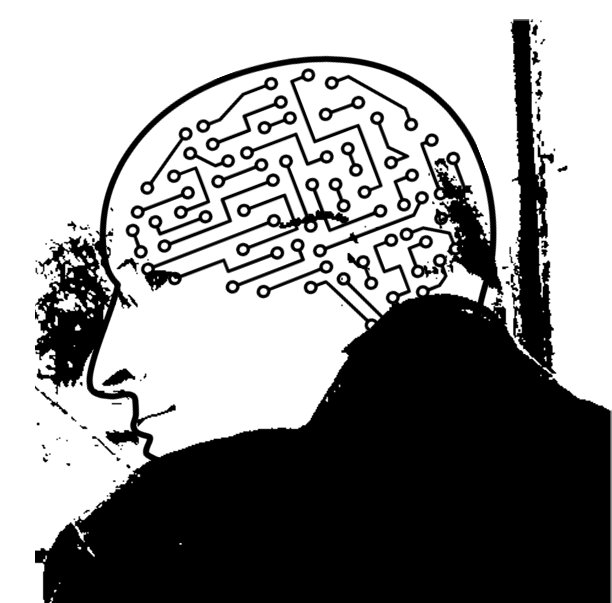
Alles nur Science-Fiction?
Eigentlich könnte ich jetzt aufhören. Denn bisher sitzen immer noch Menschen hinter den Algorithmen und halten die Kontrolle in ihrer Hand. Aber diese Menschen sind Spezialisten. Und da wird es gefährlich. Aus zwei Gründen. Es kommt einerseits zu einer Konzentration von Macht und Wissen und andererseits zu einer Verdummung der KI-Nutzenden. Ich bin aktuell hin- und hergerissen, wie ich die Nutzung von KI – im landläufigen Sinn, nicht nach meinem eng gefassten persönlichen Verständnis – bewerten soll. In der Medizin liegen ungeahnte Möglichkeiten sowohl in der Diagnostik als auch in der personalisierten Therapie von Krebs und anderen Geißeln der Menschheit. Solange ärztliches Personal aus Fleisch und Blut ein Auge auf die Ergebnisse hat, kann ich bei der Anwendung von KI in der Medizin gut mitgehen. Auch bei den oben schon genannten Fällen wie Übersetzungen oder dem Erstellen von Meeting-Protokollen kann ich mir einen KI-Einsatz gut vorstellen.
Wann wird es beim Einsatz von KI gruselig?
Im Personalwesen wird KI eingesetzt, um Bewerberinnen und Bewerber vorzusortieren. Da wird es für mich schon kritischer. Es fehlt der Human Factor. Es mag jedoch sein, dass sich die KI hier selbst ausspielt. Wer sich auf eine Position bewirbt, bei der Kandidatinnen und Kandidaten durch einen KI-Filter laufen, kann sein Bewerbungsschreiben ja auch durch KI optimieren lassen. Was ist mit solchen Systemen letztendlich gewonnen, wenn alle diese Möglichkeit nutzen? Es gibt bei Dating Apps mittlerweile Szenarien, wo der Chat-Verlauf auf beiden Seiten durch KI generiert wird. Man versteht sich daher wunderbar, aber was passiert, wenn sich die beiden Chattenden zum ersten Date treffen und ihr digitales Schneckenhaus tatsächlich verlassen müssen? Und dann sind da noch die unzähligen Möglichkeiten der Überwachung – Palantir sei als aktuelles Beispiel genannt – die wahrlich angsteinflößend sein können. KI kann in bestimmten Ausprägungen die Demokratie aushöhlen.
Auf der Anwenderseite stehe ich als Ghostwriter beim Verfassen von Webtexten häufig vor dem Problem, zum einen SEO-optimierte Texte abzuliefern, zum anderen aber Unique Content zu erstellen. Da beißt sich die Katze in den Schwanz. Die ganzen KI-Bots, die SEO bewerten, orientieren sich ja gerade an bestehenden Texten zum gleichen Thema. Ich habe noch keinen Experten und keine Expertin gesprochen, die mir dieses Thema widerspruchslos aufdröseln konnten.
Generative KI in der Kunst
Urheberschaft
Ich vertrete hier die klassische Perspektive von Kunstschaffenden. Generative KI, egal ob damit Bilder, Songs oder Texte erstellt werden, greift auf Daten zurück, die eigentlich urheberrechtlich geschützt sein sollten. Ich lasse jetzt mal Ausnahmen wie Satire unberücksichtigt. Generative KI bedient sich jedoch aktuell schamlos an einem Pool von kreativen Ideen, für die deren Urheberinnen und Urheber keinerlei Kompensation erhalten. Das ist für mich ein No-Go.
Vereinfachung, aber nicht mehr Kreativität
Sicherlich wird es für viele Menschen einfacher und auch amüsanter, ihre Social Media Accounts zu füttern. Ich bin kein Grafiker, Maler oder Musiker, aber aus der Schriftstellerperspektive ergeben sich ein paar nette Optionen. Self-Publisher können ihre Cover selbst erstellen und ihren Followern Bilder ihrer Charaktere nahebringen. Aber nimmt man Büchern damit nicht genau das, was sie ausmachen sollte? Greift man damit nicht in die Fantasie der Leserschaft ein? Meine eigene Fantasie sieht jedenfalls anders aus als mir die KI vorgibt. Ich habe mal probiert, die Charaktere meines Romans „Die Drachenverschwörung“ von diversen KIs darstellen zu lassen. Am besten gelungen ist dabei die Para-Agentin Susanne Brinkmann (siehe Bild). Richtig zufrieden bin ich trotzdem nicht. Ich weiß nicht, mit was für Schönheitsidealen die KI-Algorithmen gefüttert werden. Die Vorgabe war „leicht mollig“. Und wenn man die Prompts immer weiter anpasst (curvy, rundlich, etc.), dann reagiert die KI nicht. Nur irgendwann kommt ein Sprung und die dargestellte Frau hat die klare Diagnose Adipositas.

Demokratisierung mit Wertverlust
Aber zurück zum Grundsätzlichen: Mit dem Einsatz von KI wird der Zugang zur Kunst zwar demokratisiert, jedoch erfahren Künstlerinnen und Künstler, die sich mit Talent und Fleiß Techniken erarbeitet haben, eine Abwertung ihrer Kunst. Ich weiß nicht, ob das alles so toll ist. Ich denke, man kann sich aber auf einen Minimalkonsens einigen, dass der Gebrauch von KI kenntlich gemacht worden soll.
Generative KI in der Wissenschaft
Qualität der Ergebnisse
Beim Einsatz von KI zum Erstellen wissenschaftlicher Arbeiten schwanke ich noch, aber meine Tendenz geht auch hier in Richtung Ablehnung. Diverse Universitäten und Institute erlauben den Einsatz bereits, wenn er kenntlich gemacht wird. Das reicht von einer einfachen Rechtschreibkorrektur bis hin zum Zusammenfassen relevanter Literaturstellen. Aktuell rate ich von der Nutzung von KI-Tools zur Erstellung von Bachelor- oder Masterarbeiten ab. Als Ghostwriter, Korrektor und Lektor landen häufig wissenschaftliche Texte auf meinem Schreibtisch (korrekterweise: auf meiner Festplatte), die von einer KI verbockt wurden. Rechtschreibung und Grammatik sind 1A, aber wie bei Quellen und wissenschaftlichen Fakten halluziniert wird, das ist nicht mehr feierlich. Was dort abgeliefert wird, sind falsche und ausgedachte Zitate. Die Autorinnen und Autoren der zitierten Quellen mag es zwar geben, aber Titel des Papers und Erscheinungsjahr passen oft nicht zusammen. Formales richtiges Zitieren ist schon schwer genug, und Fehler bei der Umsetzung haben einige Prominente ja bereits ihren Doktortitel gekostet. Aber inhaltlich falsches Zitieren ist gravierend. Die von der KI generierten Texte sind darüber hinaus oft oberflächlich und gehen nicht in die Tiefe. Außerdem neigt die KI zu obsessiven Wiederholungen. Sicherlich bessert sich da gerade vieles. Und ich gebe zu, dass man über die Gestaltung der Prompts auch Einfluss auf die Qualität der Texte nehmen kann. Eine Stückelung in viele kleine Teilaufgaben erhöht die inhaltliche Tiefe – wenn man es geschickt anstellt. Ich muss auch einschränkend sagen, dass ich aktuell nur KI-Tools bewerten kann, die umsonst oder für wenig Geld genutzt werden können. Bis menschliche Lektoren abgeschafft werden, muss die KI jedenfalls noch viel lernen. Mir fehlt zurzeit ein Gefühl dafür, was KI irgendwann mal wirklich leisten kann und wie bedrohlich sie letztendlich ist.
Kompetenz der Anwendenden
Die Qualität der wissenschaftlichen Arbeit, der Thesis, ist aber nur ein Aspekt. Ein anderer wichtiger Aspekt ist, was das Outsourcen aller relevanten Tätigkeiten an die KI mit den Studentinnen und Studenten macht. Es gibt eine große neue Studie darüber, dass das fehlende Eintauchen und intensive Beschäftigen mit einem spezifischen Thema einen negativen Einfluss auf die neuronalen Aktivitäten der Studierenden haben. Die Studie vergleicht Studierende, die beim Schreiben eines Aufsatzes entweder auf eine KI, auf eine Suchmaschine oder nur auf ihr eigenes Gehirn zugreifen (vgl. Hauptmann et al., 2025). Ergebnis dieser Studie: Je intensiver die digitale Hilfestellung, desto größer die kognitiven Defizite. Die Methodenkompetenz sinkt, die Gedächtnisleistung ist reduziert und – vielleicht die schlimmste Nebenwirkung – die Lernfähigkeit und die Selbstständigkeit leiden. Wollen wir das wirklich? Die Wissenschaft soll Neugier, analytisches Denken und Problemlösungskompetenz befördern. Mit KI scheint das Gegenteil der Fall zu sein.
Bleibt Menschen
KI sollte dosiert eingesetzt werden. Ich propagiere selbst immer, dass man innovativen Entwicklungen gegenüber aufgeschlossen sein sollte. Das heißt aber nicht, dass bei neuen Technologien die Gefahren außer Acht gelassen werden sollten. Geben wir irgendwann sogar unsere Emotionen an die KI ab und vergessen dabei, was uns als Menschen ausmacht? Wollen wir uns zu Sklaven der Algorithmen machen? Ich hoffe nicht, aber wirklich sicher bin ich mir nicht, ob diese Entwicklung aufzuhalten oder zumindest zu kontrollieren ist. Mein Fazit ist jedenfalls, dass die Argumente gegen generative KI sowohl in der Kunst als auch in der Wissenschaft überwiegen.
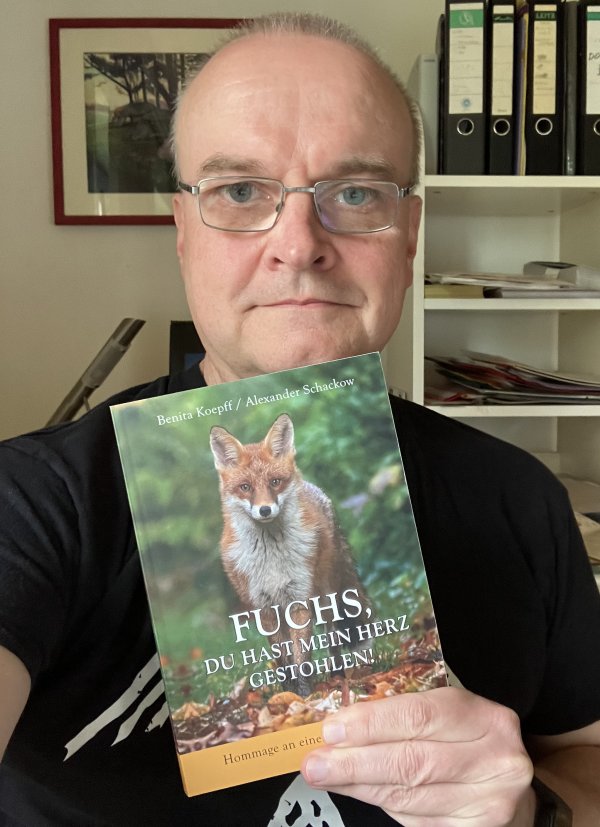
Ich bin freiberuflicher Ghostwriter und Lektor für Texte vom Roman über die Biografie und den Blogbeitrag bis zum Sachbuch oder Werbetext. Außerdem betätige ich mich als Coach für wissenschaftliches Arbeiten. Als promovierter Naturwissenschaftler (Chemiker) sind mir Struktur und Genauigkeit bei Texten aller Art wichtig. Aus meiner 20jährigen Berufserfahrung als Führungskraft und Projektleiter in der High-Tech-Industrie, die zeitweise auch Marketing-Aufgaben beinhaltete, weiß ich: Es braucht immer auch Storytelling, um eine Zielgruppe für ein Thema zu interessieren.