Was wissen Archäologinnen über die Sprache der Steinzeit?
Habt ihr euch schon einmal überlegt, wie sehr sich unsere Sprache allein in den letzten noch nicht einmal 1000 Jahren vom Mittelhochdeutschen bis jetzt verändert hat? Ich finde in diesem Zusammenhang die Überlegung interessant, wie die Menschen wohl vor 3000 oder gar 5000 Jahren, also in der Jungsteinzeit, gesprochen haben. Die Altsteinzeit begann vor ca. 2,5 Millionen Jahren. Es wird davon ausgegangen, dass in sehr früher Zeit die Kommunikation über Gesten, Grunzlaute und Schreie ablief. Die älteste überlieferte Schriftsprache ist sumerisch. Schriftzeichen oder Symbole, die als frühe Schriftform bezeichnet werden könnten, gibt es seit etwa 10.000 Jahren. Das deutet darauf hin, dass es zu der Zeit schon komplexe Sprache gegeben haben müsste. Bilder, wie frau sie von mehreren 10.000 Jahre alten Höhlenmalereien kennt, könnten ein Zeichen dafür sein, dass Sprache schon früher existiert hat, vielleicht in einer einfacheren Form.
Archäologie oder Sprachwissenschaft?
Die Wissenschaftlerinnen, die sich mit der Sprache der frühen Menschen beschäftigen, sind keine Archäologinnen, sondern Sprachwissenschaftlerinnen. Sie sind tatsächlich in der Lage, alte und vergessene Sprachen zu rekonstruieren. Das geschieht über die Erforschung von Lautverschiebungen (z.B. „ch“ vs. „k“) und nachverfolgbaren Grammatikänderungen. Diese Methode erlaubt eine Rückverfolgung in die Vergangenheit, die bis zu 7.000 Jahre zurückreicht. So wurde beispielsweise ermittelt, dass der Steinzeitmensch „Ötzi“ eine Art Urform des Rätischen gesprochen haben muss.

Grammatikanpassung bei der Kulturrevolution?
Was mir bisher noch niemand beantworten konnte, ist, ob es mit der „Kulturrevolution“, die mit Ackerbau und Viehzucht einherging, eine Grammatikanpassung gab, die sich auf geschlechterspezifische Aspekte herunterbrechen lässt. Die Wissenschaft geht davon aus, dass es vor 8.000 Jahren bereits komplexe Sprachen mit entsprechend ausgereifter Grammatik gab. Der Übergang von den Jägerinnen und Sammlerinnen zu den Ackerbäuerinnen und Viehzüchterinnen ging nach heutigen Erkenntnissen mit einer Neudefinition der Geschlechterrollen einher. Bei den Jägerinnen und Sammlerinnen waren Frauen und Männer wahrscheinlich gleichberechtigt in alle Tätigkeiten des täglichen Lebens involviert. Mit der Sesshaftwerdung hielt dagegen das Patriarchat Einzug. Die Frage ist, ob das auch zu neuen Sprachmustern geführt hat. Nichts davon ist bewiesen, aber ich stelle mir vor, dass die frühe Sprache eher geschlechtsneutral aufgebaut war (so ist es heute im Englischen ja prinzipiell auch noch). Das heißt ja eigentlich, Gendern in Reinform beziehungsweise es ist gar nicht nötig. Sprachformen, in denen männliche Denkmuster dominieren, wären dieser Theorie nach erst mit dem Patriarchat möglich gewesen, können aber auch später entstanden sein. Schade eigentlich, dass es keine schriftlichen Überlieferungen von den Jägerinnen und Sammlerinnen gibt.

Was macht Archäologie?
Nachdem im ersten Teil des Beitrags die Arbeit der Archäologinnen etwas zu kurz gekommen ist, soll ihnen dann doch der zweite Teil gewidmet sein, aber mit einem sprachwissenschaftlichen Einstieg. Das Tätigkeitsgebiet einer Archäologin, die Archäologie, setzt sich etymologisch aus den griechischen Begriffen archaios (alt, ursprünglich, altertümlich) und logos (Lehre, Wissenschaft) zusammen. Archäologinnen beschäftigen sich also mit alten Dingen. Wenn ich Dolmen und Großsteingräber aufsuche, treffe ich Archäologinnen selten bei der Arbeit an. Wenn nämlich noch Ausgrabungen oder – wie im Fall des abgebildeten Sa Coveccada Dolmens auf Sardinien – Restaurierungen laufen, dann sind die Bauwerke meistens weiträumig abgesperrt und normale Besucherinnen haben keinen Zugang.
Archäologinnen graben heutzutage deutlich weniger als früher. Moderne Methoden der Archäologie nutzen Luftaufklärung und HighTech-Sensorik zur Bodenerkundung. Computersimulationen und ausgefeilteste Analysen wie die Radiocarbondatierung alter Überreste haben aus Archäologinnen hochgerüstete Wissenschaftlerinnen gemacht.
Sa Coveccada bei Mores, Sassari, Sardinien
Noch ein Wort zum abgebildeten Dolmen unter dem Gerüst, der kaum zu erkennen ist. Sa Coveccada ist der größte Dolmen Sardiniens. Quadratisch, praktisch, gut, so bestand die über 4000 Jahre alte Gigantin einst aus fünf riesigen Platten. Die hintere Wand fehlt. Das Steinmaterial ist rosafarbener Trachyt. Und damit endet dieser Blogbeitrag, den ich mal komplett im generischen Femininum geschrieben habe. Ich muss zugeben, dass es echte Konzentration fordert, das konsequent durchzuziehen, und ich frage mich, wie viele Männer sich beim Lesen wohl mitgemeint fühlen.
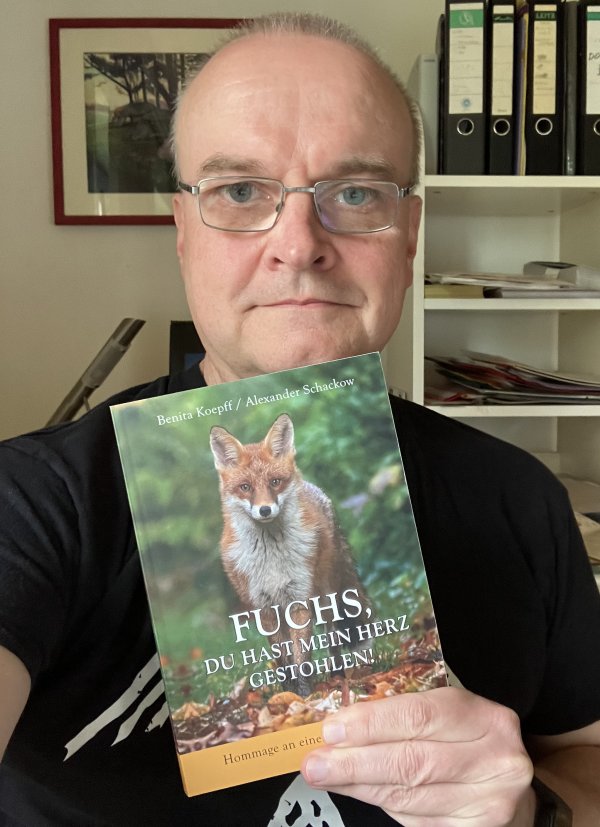
Ich bin freiberuflicher Ghostwriter und Lektor für Texte vom Roman über die Biografie und den Blogbeitrag bis zum Sachbuch oder Werbetext. Außerdem betätige ich mich als Coach für wissenschaftliches Arbeiten. Als promovierter Naturwissenschaftler (Chemiker) sind mir Struktur und Genauigkeit bei Texten aller Art wichtig. Aus meiner 20jährigen Berufserfahrung als Führungskraft und Projektleiter in der High-Tech-Industrie, die zeitweise auch Marketing-Aufgaben beinhaltete, weiß ich: Es braucht immer auch Storytelling, um eine Zielgruppe für ein Thema zu interessieren.